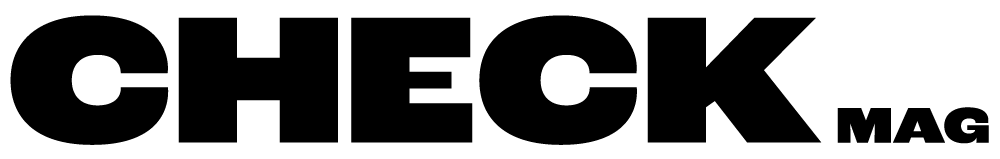Empathie und Angst: Eine unterschätzte Beziehung

Empathie gilt als moralische Superkraft. Doch unsere Zeit zeigt etwas Merkwürdiges: Empathie verschwindet nicht – sie verengt sich. Wir fühlen intensiver, selektiver, parteiischer. Empathie löst sich nicht auf. Sie richtet sich aus – und sie lässt sich umleiten.
Die neue Selektivität
Wer sich in andere einfühlen kann, übernimmt nicht nur Gefühle, sondern Resonanzen. Neurowissenschaftlich wird dieser Vorgang mit Spiegelneuronen beschrieben, doch entscheidend ist weniger die Biologie als die Frage, wen wir überhaupt spiegeln. Studien zeigen: Je stärker Menschen mit der „eigenen“ politischen Gruppe mitfühlen, desto feindseliger reagieren sie auf die andere. In manchen Experimenten entstand sogar Schadenfreude, wenn Vertreter der Gegenpartei verletzt wurden. Empathie wird damit zu einer Kraft, die nicht nur verbindet, sondern auch trennt.
Online verstärkt sich diese Dynamik. Algorithmen bevorzugen Inhalte, die emotionale Resonanz erzeugen, nicht jene, die differenzieren. Was uns erregt, erscheint häufiger; was uns herausfordert, verschwindet aus dem Sichtfeld. Unsere Empathie verliert dadurch nicht an Intensität – sie bekommt Scheuklappen.
Empathie klingt nach Nähe, aber sie erzeugt auch Anspannung. Wer sich einfühlt, öffnet sich – und wo Offenheit entsteht, entsteht immer auch ein Moment der Angst: die Unsicherheit, ob wir den anderen richtig deuten, ob wir etwas übersehen, ob wir uns verletzlich machen. Angst ist damit keine Gegenspielerin der Empathie, sondern ihr Schatten, der immer mitläuft – besonders dann, wenn wir glauben, moralisch eindeutig zu handeln.
Ähnlichkeit, Nähe und die blinden Flecken
Einen emotionalen Gleichklang erleben wir besonders leicht mit Menschen, die uns ähneln – äußerlich, kulturell, sozial. Das ist verständlich, aber folgenreich: Je homogener unsere Bezugspunkte, desto schmaler wird der innere Raum, in dem wir noch überrascht werden können.
Die ältere Dame, die langsam durch die U-Bahn-Station geht, fällt in diesem Raster schnell heraus. Ihre Bewegungen spiegeln wir nicht, wir reagieren gereizt. Das Problem ist nicht die fehlende Information, sondern das fehlende Mitgehen.
Eine aktuelle Generationenstudie zeigt: Babyboomer, Millennials und Gen Z unterscheiden sich in ihren Werten weit weniger, als das öffentliche Gespräch vermuten lässt. Familie, Freiheit, Gesundheit – dieselben Prioritäten, dieselben Sorgen. Wenn die Werte so ähnlich sind, warum ist der Ton so scharf?
Weil nicht Werte polarisieren, sondern die Verteilung von Empathie. Gruppen fühlen mit Gruppen, Individuen mit ihresgleichen, digitale Räume verstärken beides. Der Mensch verschwindet, die Zugehörigkeit bleibt.
Wenn Empathie bricht
Empathie lässt sich studieren, messen, trainieren – doch im wirklichen Leben tritt sie viel roher auf. Sie erscheint in Momenten, die man sich nicht aussucht.
Wer etwa einen an Alzheimer-Demenz erkrankten Menschen begleitet, dessen innere Welt sich auflöst, erlebt eine Form der Empathie, die über bloßes Mitfühlen hinausgeht. Man kann Reaktionen voraussehen, aber nicht verhindern. Man spürt Gefühle, erhält aber keine Antworten. Nähe bleibt erhalten, während die Beziehung sich verändert.
Hier wird deutlich, wie eng Empathie und Angst miteinander verwoben sind. Die Kondition ist das, was geschieht. Der Gegner ist das, was es in uns auslöst. Angst entsteht hier nicht aus Fremdheit, sondern aus Nähe. Sie ist die unmittelbare Reaktion auf den Verlust von Verlässlichkeit: auf die Ahnung, dass wir fühlen, ohne beeinflussen zu können. Genau in diesem Zwischenraum – zwischen Mitgefühl und Machtlosigkeit – zeigt sich, wie tief Empathie und Angst verbunden sind.
Wer empathisch bleibt, lernt deshalb zuerst, die eigene Angst mitzuführen.
Empathie und Angst als Navigationsinstrument
In solchen Situationen wird Empathie zu einer täglichen Praxis der Selbstregulation. Sie ist weniger ein moralisches Ideal als ein Ringen mit Alarmbereitschaft, Ohnmacht und Selbstschutz. Und zugleich ein stilles Wissen: Wir können die Empfindungen anderer nicht ablegen, wir können nur lernen, mit ihnen zu stehen.
Vielleicht sollten wir Empathie deshalb nicht als Emotion verstehen, sondern als kognitives Werkzeug – eines, das wir gut in Schuss halten müssen, um die eigene innere Orientierung nicht zu verlieren. Denn mit der Kognition löst sich auch die Empathie auf. Wo das Denken schwächer wird, wird auch die Fähigkeit, sich einzufühlen, brüchig.
Empathie ist damit nicht nur eine soziale Kompetenz, sondern ein Navigationsinstrument, das uns hilft, in Beziehung zur Welt zu bleiben.
Empathie ist kein Besitzstand und kein Charaktermerkmal. Sie ist eine Richtung.
Und wir entscheiden jeden Tag, wohin sie zeigt.
Bildnachweis: @ Floris Van Cauwelaert auf Unsplash